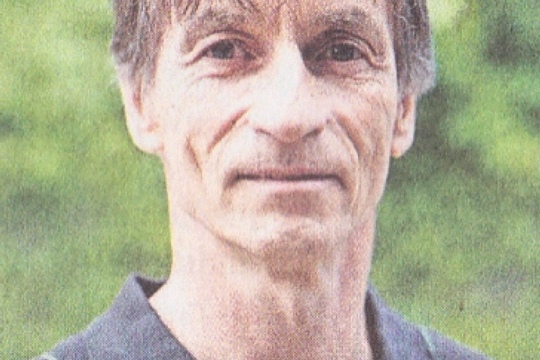Neue Biogasanlage KEWU AG schlägt Alarm - Im Grüngut landet bei weitem nicht nur Grünes
Die Biogasanlagen schlagen Alarm: Im angelieferten Grüngut hat es zu viel Plastik. Der Kewu AG im Laufengraben macht das Problem besonders zu schaffen. Falls es nicht bessert, muss die neue Biogasanlage im schlimmsten Fall wieder geschlossen werden.
Der Schredder rattert. Das Grüngut, das auf dem Förderband aus dem Schredder kommt, dampft – und riecht streng. Um nicht zu sagen: Es stinkt. Der Mann, der hier arbeitet, trägt deshalb eine Frischluftmaske. Er steht am Förderband und schaut sich die dunkle Grüngutmasse genau an. Entdeckt er einen Fremdstoff, zum Beispiel einen Plastiksack oder einen Blumentopf aus Kunststoff, fischt er diesen von Hand heraus. Kommt zu viel Plastik aufs Mal, drückt er den roten Knopf. Dann stoppt das Förderband, sodass genug Zeit bleibt, um alles auszusortieren, was nicht ins Grüngut gehört.
«Das ist keine schöne Arbeit», sagt Hans Buess, der technische Leiter der Kewu AG. Die Firma betreibt im Laufengraben bei Bolligen eine Biogasanlage. 13 Gemeinden liefern ihr Grüngut hierher, die grössten sind Ostermundigen, Muri, Ittigen und Worb. Seit die Biogasanlage in Betrieb ist, kann die Bevölkerung auch Speiseabfälle im Grüngut entsorgen. Denn Speiseabfälle sind besonders energiereich, erzeugen besonders viel Biogas.
13 000 Tonnen pro Jahr
Doch seit dieser Neuerung hat die Kewu ein Problem: Im Grüngut landen nämlich viele Fremdstoffe. Metallische Stoffe sind nicht das Hauptproblem; sie können mithilfe eines Magneten entfernt werden. «Schauen Sie», sagt Hans Buess und zeigt auf einen Haufen mit Küchenmessern, Zapfenziehern, Gartenscheren, Hämmern, Armierungseisen und sogar einem Pickel. Das hat der Magnet bereits aus dem Grüngut gezogen. Mehr Kopfzerbrechen bereiten die nicht metallischen Fremdstoffe. Zigarettenschachteln, Getränkeverpackungen, Kaffeekapseln und vor allem: Plastiksäcke. All das muss von Hand entfernt werden.
Die Kewu AG, die jährlich 13 000 Tonnen Küchen- und Gartenabfälle entgegennimmt, ist mit dem Problem nicht allein. Auch viele andere Betreiber leiden unter der zunehmenden Menge von Fremdstoffen im Grüngut, bestätigt Andreas Utiger, Geschäftsführer des Branchenverbandes Biomasse Suisse. Gründe sieht er mehrere: In manchen Haushalten seien zu wenige Kenntnisse in Sachen Grüngut vorhanden, «die Leute meinen, dass zum Beispiel Plastiksäcke problemlos entfernt werden können», so Utiger. Auch kulturelle Unterschiede spielten eine Rolle: Viele Einwanderer seien das hiesige Abfalltrennungssystem schlicht nicht gewohnt.
Das WorstCaseSzenario
Nicht nur in städtischen Gebieten lande viel Plastik im Grüngut, sondern auch auf dem Land, sagt Kewu-Mann Hans Buess. Für ihn ist klar: «So kann es nicht weitergehen.» Er holt aus, erklärt den Grüngutkreislauf. Nachdem das Grüngut geschreddert ist, lagert die Masse einen Monat in der Vergärungsanlage. Mit dem Gas, das dort entsteht, wird Strom für rund 400 Haushalte produziert. Zurück bleibt das sogenannte Gärgut. Dieses kommt in die Kompostieranlage. Nach einem weiteren Monat wird das Material nochmals gesiebt. Übrig bleibt Kompost, den Gärtner und Landwirte als Düngemittel auf die Felder austragen.
Die vielen Plastikteilchen im Kompost verunreinigen den ganzen Ökokreislauf und sorgen für Reklamationen bei den Abnehmern. Es wird immer schwieriger, den Kompost loszuwerden. Den Anteil an Fremdstoffen zu reduzieren, ist für Anlagenbetreiber wie die Kewu aber schwierig: Die technischen Möglichkeiten sind beschränkt, und das Aussortieren von Hand kostet. Irgendwann könne die Biogasanlage nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, sagt Hans Buess. Im schlimmsten Fall müsse die anderthalbjährige Anlage, in welche die Kewu 12 Millionen Franken investierte, sogar ausser Betrieb genommen werden.
PR-Büro engagiert
Die Kewu AG gehört den 13 angeschlossenen Gemeinden. Diese haben also ein Interesse daran, das Problem in den Griff zu bekommen. Doch wie? «Man muss dort ansetzen, wo das Grüngut herkommt», ist Andreas Utiger von Biomasse Suisse überzeugt. Wichtig sei unter anderem eine umfassende Aufklärungsarbeit. Diesbezüglich hat die Kewu bereits einiges getan. Sie hat eine Kommunikationsagentur engagiert, Flyer in alle Haushalte verschickt und, und, und. Dafür gibt sie pro Jahr zwischen 50 000 und 100 000 Franken aus.
«Wo die Aufklärung nicht fruchtet, braucht es griffige Instrumente», sagt Andreas Utiger. Dann müssten die Gemeinden auch zu unpopulären Massnahmen greifen, bis hin zu Bussen.
«Hotspots» eruieren
Hans Buess von der Kewu startet eine Powerpoint-Präsentation, klickt zur Seite mit dem Titel «Lösungsansätze». Schritt eins: «Hotspots identifizieren». Zusammen mit den Transportunternehmen, die das Grüngut einsammeln, will die Kewu eruieren, woher besonders viel verunreinigtes Grüngut angeliefert wird. Im zweiten Schritt werden diese Hotspots dann «bearbeitet», das heisst: Grüngutcontainer mit vielen Fremdstoffen werden stehen gelassen. Nötigenfalls spricht man direkt vor Ort beim Hauswart oder bei der Liegenschaftsverwaltung vor, damit sie die Mieter beim Grüngut stärker in die Pflicht nehmen.
DAS BEISPIEL OSTERMUNDIGEN
Was tun die Gemeinden gegen das Plastikproblem im Grüngut? Ostermundigen, die grösste der 13 Kewu-Gemeinden, setzt verschiedene Massnahmen um. Angefangen bei der Information: So verschicken die Behörden zum Beispiel jedes Jahr eine Abfallbroschüre in alle Haushalte – in zwölf Sprachen von Albanisch über Deutsch bis Tamilisch.
Trotzdem landet immer wieder Plastik in den Küchen- und Gartenabfällen. Für Fehlbare könnte die Gemeinde Bussen aussprechen, so wie bei illegal entsorgtem Hauskehricht. Zuerst versuche man das Problem aber anders zu lösen, sagt Yves Gaudens, Leiter der Ostermundiger Abteilung Tiefbau und Betriebe. Nämlich so: Entdecken die Gemeindemitarbeiter auf der Grünguttour Plastik in den Küchen- und Gartenabfällen, werden sie künftig einen roten Kleber auf dem Container anbringen und diesen stehen lassen. Soll der Container nächstes Mal geleert werden, muss er nochmals sortiert werden. Ansonsten bleibt er weiter stehen. «Irgendwann wird das unangenehm für die Leute», sagt Gaudens. Dann steige der Druck, das Grüngut richtig bereitzustellen.